Experten/innen im Gespräch - mitgelauscht
Interview mit der Steuerberaterin (Schwerpunkt Kunst) Frau Dr. Ariane Reichard, Geschäftsführerin der Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nickel GmbH.
Dr. Ariane Reichard hat in Kunststeuerrecht bereits 2003 promoviert. Seitdem begleiten sie die Kunstfragen in ihrem beruflichen Steueralltag im unterschiedlichen Kontext. Ich freue mich sehr mit Ihr heute über die „knifligen“ Fragen austauschen zu können. Sie dürfen gern mitlauschen.
Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die Aussagen des Interviews keine Beratung sind und auch diese nicht ersetzen. Das Gespräch soll lediglich darauf aufmerksam machen, bestimmte Aspekte im Kotext der Kunst und Steuer zu bedenken.
TEIL 1
Was sollte ich bei einem privaten Kunstkauf steuerlich beachten?
- Spekulationsfrist
- Kunsttipp: Kunstkauf privat im Hinblick als Anlage
- Kunst-Erb-Vorgang

Spekulationsfrist
Kann auch ein privater Kunstkauf steuerlich geltend gemacht werden?
Die Situation ist meistens folgende: Wenn ein Kunstgegenstand privat erworben wird, denkt man zuerst, das ist nicht steuerlich relevant. Man bewahrt die Rechnung und das Zertifikat auf und dann ist die Sache erstmals erledigt.
Vom Grundansatz ist diese Handlungsweise für Privatpersonen an sich auch richtig, denn wie der Name bereits sagt „Privatpersonen“ agieren normalerweise in ihrer privaten Sphäre. Die private Sphäre ist steuerlich erstmals nicht relevant. Hier ist jeder frei das zu machen, was sie oder er möchte.
Im Steuerrecht gibt es immer ein großes „Aber“ und gefühlt mindestens immer eine Ausnahme zu dem großen Grundsatz. So ist es auch in diesem Bereich (Kunstkauf privat).
Wenn man innerhalb eines Jahres z. B. ein Gemälde kauft und wieder verkauft bewegt man sich innerhalb der Spekulationsfrist (ähnlich wie bei Immobilien, zehn Jahre). Das Gesetz spricht hier von anderen Wirtschaftsgütern bzw. -gegenständen, darunter würden auch Kunstgegenstände fallen.
Ein Jahr als Spekulationszeit für private Kunstkäufe merken. Hier auch nicht das Verkaufsdatum auf den Tag genau setzen, sondern ein wenig Zeit einräumen.
Wie ist es, wenn z.B. ein Kunstbesitzer eine Anfrage von einem Museum, einer Galerie, Stiftung o. ä. bekommt, die an dem Bild interessiert ist, um das Bild einer Ausstellung zur Verfügung zu stellen?
Vom Grundsatz kann das jeder so machen, wie er möchte. Steuerlich muss man hier wieder aufpassen, dass sich die Spekulationsfrist nicht von einem auf zehn Jahre verlängert. Das kann passieren, wenn man mit einem Produkt oder Dienstleistung Einkünfte erzielen möchte und dieses auch realisiert.
Die Voraussetzung für diese Verlängerung ist, dass der Kunstinhaber es gegen Gebühr zur Verfügung stellt, oder? Wie verhält es sich mit der Steuer, wenn man es kostenlos ausleiht?
Das Gesetz redet von Einkünften. Technisch heißt es: Man muss zumindest eine Einkunftserzielungsabsicht haben, was darauf hindeutet, dass man sich nicht mehr im ganz klassischen Sinne als Privatperson bewegt, sondern zumindest in den unternehmerischen Bereich ein wenig reinrutscht.
Wenn ich etwas gegen Gebühr vermiete, bin ich – wie mit anderen Einkunftsarten, die wir so kennen – dann doch im steuerpflichtigen Bereich.
Wenn ich als Kunstbesitzer mich geehrt fühle, dass mein Bild in dieser Ausstellung hängt, …, man bekommt dafür nichts, …, man besucht sein eigenes Bild sonntags in der Galerie, dann ist das steuerlich erstmals irrelevant. Das ist eine völlig privat motivierte Aktion.
Kritisch wird es, wenn man das Ausleihen ein bisschen öfters in den 10 Jahren macht.
Das ist immer das Thema, wenn man sich anfängt wie ein Unternehmer auf dem Markt zu bewegen (denken wir hier wieder an den An- und Verkauf).
Nochmal zurückgehend auf das Beispiel aus dem Immobilienbereich: Viele kennen die allgemeinberüchtigte Drei-Objekte-Grenze: Wenn man innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes mehr als drei Objekte an- und verkauft, sagt die Finanzverwaltung: „Naja, das ist nicht mehr privat agierend. Lieber Steuerpflichtiger Du bewegst Dich hier wie ein Unternehmer auf dem Markt. Du machst es mit einer gewissen Nachhaltigkeit.“
Vielleicht steckt auch ein Plan dahinter, weil man heute schon weiß, dass man in einem Jahr das Bild x, im nächsten Jahr das Bild y und darauf das Bild z verkaufen möchte. Man kennt die Branche. Man nutzt gewisse Dinge an dem Markt aus. Dann ist man das was jeder andere Unternehmer auch ist: Meistens ein gewerblich Handelnder und dann hat man natürlich alle Themen auf dem Tisch, die man wie jeder andere Unternehmer auch, zu beachten hat: Gewinne sind dann steuerpflichtig. Man muss gegeben falls auch an die Gewerbesteuer denken. Man muss an die Umsatzsteuer denken. Auch diese Aspekte müssen in den Rechnungen beachtet und richtig gemacht werden.
Das alles bekommt dann eine ganz andere Dimension. Das ist richtig.
Zusammengefasst
- Privater Kauf ist private Sphäre - vorausgesetzt, Sie benehmen sich auch dementsprechend und nicht wie ein Unternehmer.
- Wenn Sie Kunst wieder verkaufen wollen, dann am besten erst nach mindestens einem Jahr (ab Einkaufsdatum gerechnet). Bedenken Sie hierbei die Spekulationsfrist.
- Sie können die eigenen Kunstwerke für Ausstellungen und Co durchaus ausleihen, jedoch am besten ohne Gebühr bzw. kostenlos und eher bei Gelegenheit und nicht zu oft.
- Wenn Sie die Werke doch gegen Gebühr zur Verfügung stellen wollen, dann am besten erst nach zehn Jahren ab Ankauf.
Kunsttipp: Kunstkauf privat im Hinblick als Anlage

Wie sollte man als Käufer, als Privatperson, wenn man nicht so Branchenvertraut ist eigentlich vorgehen und was ist Deine Empfehlung, Agnieszka, wenn man sich für ein Investment entscheidet? Wie lege ich z. B. ein Betrag von 10.000 Euro gut an?
Eine pauschale Antwort auf diese Frage, gibt es leider nicht.
Die Frage bei der Kunst ist immer warum man kauft. Will man investieren bzw. eine Wertanlage durch die Gemälde haben, stellt sich die Frage des Risikos – wie auch bei anderen möglichen Anlagen auch.
Relativ kleines Risiko hat die Fine Art. Die Kunst um 1900. Es ist ein wenig ältere Kunst. Das liegt daran, dass der Markt schon relativ klar ist. Die Künstler sind tot – so makaber sich das auch anhört. Man weiß ganz genau wie viel Bilder haben sie gemalt, was für Bilder sind es gewesen, welchen Wert haben bestimmte Werkschaffensphasen des Künstlers. Danach kann man auch den Wert eines Bildes „eindeutig“ beziffern.
Das ist ein relativ kleines Risiko, denn man kauft die Bilder und es ist höchst wahrscheinlich, dass man zumindest den gleichen Wert zurückbekommt.
Wenn man bereit ist ein größeres Risiko einzugehen und wirklich auch einen großen Gewinn erzielen möchte, dann ist man relativ gut in der Zeitgenössischen Kunst aufgehoben. Bei den Newcomern oder Künstlern, die bereits ein paar Jahre auf dem Markt sind, allerdings noch nicht so etabliert, dass es sofort klar ist, wenn man den Namen nennt, das es ein Künstler ist, wie z. B. Bensky, Gerhard Richter, Andreas Gursky. Bei diesen großen Namen sind es dann keine Spekulationen mehr, sondern ganz klare Investitionen. Hier stellt sich dann auch die Frage, wie hoch dann noch ein Gewinn im Endeffekt sein könnte.
Daher ist meine Empfehlung, dass man erstmals guckt: Welche Bilder gefallen mir aus der Zeitgenössischen Kunst? Was spricht mich da an? Sich mit dem Künstler ein wenig auseinanderzusetzen oder einen Berater zur Rate zu ziehen. Sich vielleicht mit dem Künstler selbst zu unterhalten. Das ist ja das Tolle an der Zeitgenössischen Kunst, dass man einen Künstler auch – wenn er nicht ganz introvertiert ist, das kommt ja auch mal in der Kunst vor – in einem Atelier besuchen kann. Dann kann man das Bild erwerben und wartet eine gewisse Zeit ab (Buy and Hold).
Der Punkt bei der Kunst ist, dass schnelle Gewinne schwierig sind. Es ist ein wenig anders als bei den Aktien, man kann Kunst nicht spontan über Nacht verkaufen.
Daher empfehle ich immer, wenn man mit Kunst als Anlage liebäugelt, dass man sich bewusst ist, dass man einige Jahre dieses Bild im eigenen Besitz hat und es auch zumindest ein wenig mögen sollte.
Nur als pure Investition Kunst zu kaufen ist schwierig.
Insofern schließt sich der Kreis zum Steuerlichen. An dieser Stelle kann man zusammenfassen, dass Privatleute sowohl aus dem eigenen Interesse heraus, also Kunst nicht als Schnellschuss kaufen sollten, um es dann wieder abzustoßen, sondern tatsächlich sich fragen sollten, was gefällt mir, dann eine Entscheidung fällen, dann auch erstmals für sich das Kunstwerk genießen
Wenn es dann tatsächlich zu einem Verkauf kommen sollte einmal die steuerlichen Themen zumindest im Hinterkopf behält und sagt: „Ok. im muss zumindest darüber einmal nachdenken: Löse ich damit etwas aus? Muss ich irgendwelche Dinge dem Finanzamt melden?“.
Zusammengefasst
- Kunst als Anlage pauschal zu beantworten ist nicht möglich. Nicht jede Kunst ist bzw. kann eine Anlage sein. Dieses ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
- Bevor Sie Kunst kaufen, stellen Sie sich erstmals die Frage: "Warum will ich (diese) Kunst kaufen?". Anschließend suchen Sie nach Ihren Kriterien die Kunst aus, die zu Ihrem persönlichen "Warum" passt.
- Setzen Sie sich vor dem Kauf mit der Epoche, Künstler, etc. auseinandersetzen bzw. informieren Sie sich darüber ein wenig. Beobachten Sie sich selbst und achten dabei: "Was interessiert mich an der Kunst bzw. was gefällt mir gerade daran so gut." Wenn Sie tiefer in die Materie einsteigen wollen oder keine Zeit haben, sich damit näher zu beschäftigen, lassen Sie sich beraten. Beachten Sie hierbei jedoch, ob Ihr Gegenüber tatsächlich primär Ihre Interessen vertritt.
- Allgemein ist ausschlaggebend - wie beim Geldanlegen allgemein -, welches Risiko Sie bereit sind einzugehen. Selbstverständlich wirkt sich dieses auch auf die mögliche Rendite aus:
- großes Risiko, wahrscheinlich hoher Gewinn, geringe Sicherheit der Werterhaltung - eher Zeitgenössische Kunst
- kleines Risiko, mehr Sicherheit der Werterhaltung, relativ geringer Gewinn - eher Fine Art
- Wobei auch hier es darauf ankommt, wie etabliert bereits die einzelnen Künstler/innen sind.
- Nicht als Schnellschuss Kunst erwerben. Besser: Buy and Hold.
- Beim Wiederverkauf bedenken Sie eventuelle steuerlichen Fragen.
Kunst-Erb-Vorgang
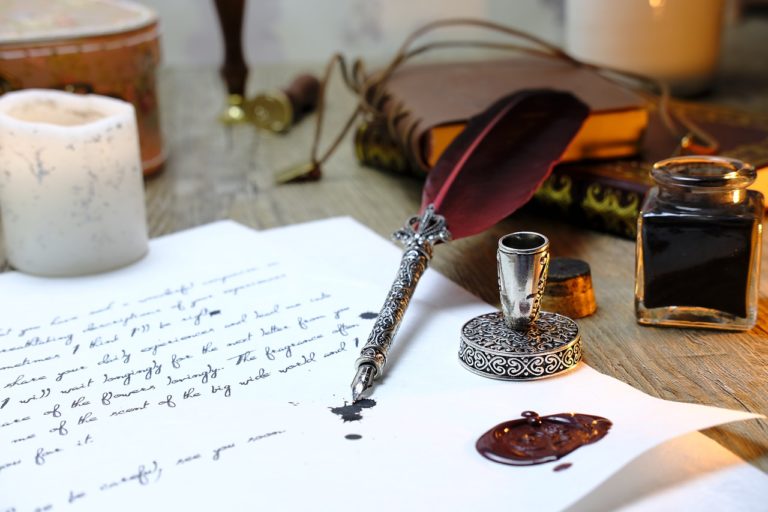
Es ist jedoch nicht nur der Tod des Künstlers, den man manchmal in Erwägung ziehen muss, sondern es gibt auch die Fälle, wie Erbfälle, wo jemand in der Familie verstirbt und in dem Nachlass sich auch Kunstgegenstände befinden. Auch da stellt sich für uns beide die Frage: Was macht man mit so einem Vorgang?
Für uns ist es natürlich immer die Frage die Erstellung der richtigen Erbschaftssteuererklärung, weil eben auch Kunst/Kunstgegenstände auch ein Teil der Erbmasse sind und damit auch Eingang in die Erbschaftssteuer finden sollten. Hier sollte man an sich zumindest im Vorfeld die Frage stellen: „Ist jetzt tatsächlich ein Gemälde, was für mich emotional wichtig ist, weil ich damit Gefühle, Personen verknüpfe, auch allgemein wertvoll?“ Oder muss man hier faktisch sagen: „Ok. Das mag für den Einzelnen einen total hohen Wert haben, aber wenn man es auf dem Markt platzieren würde, hat es eigentlich keinen Wert.“
Dann ist man auch in der Erbschaftssteuererklärung relativ schnell. Vielleicht fällt es sogar unter Hausrat. Man zeigt es einmal gegenüber dem Finanzamt an, aber es hat keine Auswirkung eigentlich auf die damit festzusetzende Erbschaftssteuer als solche.
Das andere und damit auch für Dich, Agnieszka, beruflich relevantere Thema ist, wenn man eben bei der Besichtigung einer Wohnung eines Hauses plötzlich feststellt: Da hängen doch ein, zwei Gemälde an der Wand, wo Erben den Wert erstmals schwer selbst einschätzen können.
Da letztendlich ist auch unsere totale Schnittmenge zu sagen: Wir brauchen für die Erbschaftssteuererklärung in irgendeiner Form, idealerweise ein Wertgutachten, mit dem man die steuerrelevanten Fragen klären kann.
Für Dich, Agnieszka, bedeutet das auch eine gewisse Begutachtung. Wie sind da Deine Erfahrungen?
Nicht selten ist es bei Nachlässen der Fall, dass die Erben gar nicht wirklich wissen, was da gesammelt worden ist. Sie wissen, der Vater, die Mutter oder beide zusammen haben aus Ihrer Passion heraus Bilder an den Wänden hängen gehabt, dann auch mal was aus dem Urlaub mitgenommen oder bei einer Auktion irgendwann mal etwas gekauft.
Oft ist es der Fall, dass es gar keine Unterlagen darüber gibt. Das ist etwas was die Gutachten sehr erschwert. Es macht sie fast unmöglich. Weil man in einem solchen Fall stark recherchieren muss. Wenn ich gar keinen Anhaltspunkt habe, wenn z. B. die Signatur nicht einmal da ist, oder eine Rechnung u. ä. dann ist dieses eine ganz klassische, kunsthistorische Arbeit. Eine Begutachtung in solch einem Fall ist nicht unmöglich, aber sehr aufwändig. Das ist wiederum auch zeit- und kostenspielig. Dann kann es durchaus sein, dass sich die Erben gegen ein Gutachten – das jedoch später durchaus relevant wäre – entscheiden.
Das deckt sich durchaus mit den Erfahrungen die wir in unserem steuerlichen Beratungsalltag machen. Es wird ein bisschen geguckt: Was bringt mir dieses Gutachten? Die Kosten, die ich dafür aufwenden muss, kann ich sie mir nicht letztendlich sparen?
Da muss man nochmal deutlich machen: Wenn man geerbt hat, dann ist man auch in der Verpflichtung – ganz gleich, ob man es gerade möchte oder nicht – die Werthaltigkeit dessen, was man geerbt hat, zu bestimmen. Häufig ist es der Fall, dass die Freibeträge, die es dafür gibt, absolut ausreichen und letztendlich gar keine Steuer anfällt. Aber man muss auch den sogenannten Mitwirkungspflichten gegenüber den Finanzbehörden nachkommen und zumindest dokumentieren, dass man eben diesen Vorgang geprüft hat.
Wenn man z. B. ein Gemälde in einem Möbelhaus gekauft hat, ist es der hunderttausendste Druck von etwas. Dort wird es keine Probleme geben. Aber bei Originalen wird es schwierig. Daher ist unsere Empfehlung zu sagen: „Bitte in irgendeiner Form, idealerweise mit einem Gutachten dokumentieren, dass man vielleicht einen Wert von 10.000 EUR hat und der Freibetrag definitiv darüber liegt.“ Dann zeigt man das gegenüber dem Finanzamt an, das Thema ist erledigt und alles ist steuerlich vernünftig abgearbeitet.
Andersherum betrachtet – und da sehen manche glaube ich gar nicht die steuerlichen Möglichkeiten – gibt es auch im Erbschaftssteuerrecht Steuerbefreiungsvorschriften. Wenn man das Glück hat, eine schöne Sammlung zu erben, bedeutet dies nicht gleich den steuerlichen Ruin, wenn man das entsprechend dokumentiert und dem Finanzamt gegenüber deklariert. Es gibt im Erbschaftsteuerrecht auch Steuerbefreiungsmöglichkeiten, wenn es sich um Kunstgegenstände oder eine Kunstsammlung handelt, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse ist.
Insofern sei es jedem an dieser Stelle angeraten, sich mit beiden Stellen in Verbindung zu setzen: Einmal mit einem Gutachter, der zeigen kann, dass es eben Kunst bzw. eine Kunstsammlung ist, die erhaltenswert ist. Umgekehrt greifen wir dann steuerlich ein und können das über die Anwendung der Befreiungsvorschriften auch gegenüber dem Finanzamt kommunizieren.
Man hat dann auch für Fall der Fälle, wenn man dann doch irgendwann das ein oder andere Bild veräußern möchte, und diese dann auch gewinnbringend sind, etwas in der Hand, worauf man zurückgreifen kann und sagen kann: „Zum Zeitpunkt des Erbens waren die Bilder so und so viel wert.“ Dann kann man etwas Schriftliches vorweisen.
Absolut. Die langjährige berufliche Erfahrung zeigt, dass viele häufig darauf setzen: Irgendwie komme es nicht raus. Das passt schon mit dem Freibetrag.
Aus irgendeiner unglücklichen Konstellation heraus bekommt das Finanzamt in 5, 6, 7 Jahren doch Kenntnis von einem Vorgang. Wenn es dann nicht angezeigt ist und wenn man es dann auch nicht dokumentieren kann, wie man auf gewisse Wertermittlungen kommt, löst es entsprechende unschöne Folgen aus. Weil man sich dann im Anschluss sehr langwierig mit den Finanzämtern auseinander setzen muss. Das kann man an sich mit einem sehr einfachen und simplen Weg lösen, indem man von Anfang an die notwendigen Schritte einleitet und geht.
Für mich ist es auch im Nachhinein schwierig rückwirkend ein Bild zu begutachten. Ich kann sagen es hat den Wert jetzt. Vor 8 oder 10 Jahren, zum Zeitpunkt des Erbens wird es schwierig das wirklich zuverlässig zu beziffern.
Da sich im Vergleich die Privatleute zu Unternehmern dahingehend scheuen was die Kosten betrifft, kann ich gerade in Erbschaftssteuerfällen sagen, dass man wenigstens die Kosten, die zu Wertbestimmung anfallen, in der Erbschaftssteuererklärung selber steuermildernd abziehen kann. Ja, es bleibt immer ein kleiner privater Teil hängen, aber einen Teil trägt – wenn man es so vereinfacht sagen kann – der Fiskus mit. Da bietet es sich an im individuellen Fall zu prüfen, was man macht. Zumindest einmal – wenn so ein Vorgang eintrifft – einen Gedanken daran zu verschwenden, es auf die eigene To-Do-Liste zu setzen.
Wichtig wäre an dieser Stelle von meiner Seite aus zu erwähnen, dass wenn man Kunstwerke kauft – vielleicht nicht unbedingt schon zu Beginn mit dem Ziel es eventuell zu vererben, aber vielleicht steht es doch irgendwann im Raum -, dass man die ganzen Unterlagen, die man hat, sammelt.
Man kann z. B. einen Ordner für die Kunstgegenstände anlegen – genauso wie, wenn man die Sachen für die Steuer sammelt und sagt: „Das könnte für die Einkommenssteuer am Ende des Jahres doch relevant sein.“ Man kann diejenigen, die das eigene Vertrauen genießen, einweihen und ihnen sagen: „Das ist der Ordner. Hier steht alles. Hier sind die Rechnungen, Zertifikate, vielleicht sogar Fotos, die dokumentieren dass diese Bilder im Besitz der Familie waren.“ Ein solches Foto könnte in einer ganz klassischen Situation entstanden sein, z. B. während er Weihnachtsfeier. Das Bild hängt über dem Kamin, man feiert Weihnachten, macht im Laufe der Feiertage ein Foto und im Hintergrund sieht man das Bild.
Eine solche Mappe ist für mich als Gutachterin eine sehr gute Quelle und es sind relevante Dokumente, die ins Gutachten hineinfließen und dieses sehr seriös machen.
Insofern ist es menschlich ganz interessant zu beobachten, dass viele damit selbstverständlich umgehen, wenn es um die eignen Immobilien geht. Das ist häufig unglaublich sauber dokumentiert. Da gibt es selbstverständlich den notariellen Kaufvertrag, da gibt es noch die Rechnungen über weitere Investitionen. Was hat man wann wie häufig gemacht. Das Grundbuch wird ordentlich geführt. Das durchläuft bei den meisten Privatleuten im Regelfall wie selbstverständlich. Auch bei den Aktien haben die meisten Privatanleger – vom Bankverlauf abgesehen – eine Dokumentation verfügbar. Das wird abgelegt. Es wird geordnet. Es ist dokumentiert. Da bekommt man sehr schnell einen Überblick.
Dann wechselt es in den Bereich: Schmuck, Antiquitäten, Kunst. Dann bricht diese Dokumentation irgendwie ab. Das ist anders. Das merkt man auch im Gespräch: „Ja das habe ich irgendwann mal gekauft.“.
Das ist interessant, denn es ist an sich, wenn man es würdigt, nichts anderes als wenn ich eine Aktie für 1000 EUR, ein Schmuckstück oder ein Bild für 1000 EUR kaufe. Eigentlich ist es immer gleich. Aber die Handhabung ist doch sehr unterschiedlich.
Vielleicht muss man an dieser Stelle der Fürsprecher werden. Es verändert sich. Wir wissen alle, wie die Zeiten heute sind. Aktienmärkte? Ist die Aktie von dem Konzern morgen tatsächlich das Wert, was sie heute wert ist? Immobilien? Die Immobilienpreise sind gestiegen? Will ich da jetzt investieren?
Da ist sicherlich der Kunstmarkt ein genauso interessanter Bereich , wie die anderen, er wird halt von vielen Privatleuten – auch wenn man der Frage nachgeht: „Worin könnte ich investieren?“ – irgendwie ausgeklammert. Irgendwie anders gehandhabt.
Hier vielleicht ein Veto: Auch an diesen Bereich entspannt und unverkrampft heranzugehen, wie man es in anderen Bereichen auch macht.
Genau.
Ich finde Deinen Vergleich mit den Aktien sehr gut. Im Grunde genommen ist es mit der Kunst ein bisschen ähnlich: Man kauft eine Aktie für 1000 EUR oder man kauft ein Gemälde für 1000 EUR und beobachtet die Rendite, am besten über Jahre.
Ich finde Deinen Vergleich mit den Aktien sehr gut. Im Grunde genommen ist es mit der Kunst ein bisschen ähnlich: Man kauft eine Aktie für 1000 EUR oder man kauft ein Gemälde für 1000 EUR und beobachtet die Rendite, am besten über Jahre.
Der Unterschied ist, dass man das Gemälde an der Wand hängen hat – und es nicht im Safe oder Schreibtischschublade verschwindet. Man erfreut sich sofort daran. Man kann den Besitz auch gut z. B. mit Fotos oder weiteren Unterlagen dokumentieren. Im Falle eines Wertverlustes – Worst Case – hat man zumindest ein Bild. Oft entsteht im Laufe der Jahre eine emotionale und somit nostalgische Bindung und man will im Grunde das Bild auch gar nicht veräußern, aufgrund der Erinnerungen, die mit dem Bild zusammen hängen.
Das ist ein Unterschied zu anderen Wertanlagen. Oldtimer sind auch sehr beliebt, oder Boote. Da ist auch die Wartung eine ganz andere sowie die Pflege. Der Besitzer braucht einen Stellplatz oder einen Anlegeplatz. All das sind regelmäßige Folgekosten.
Das ist ein Unterschied zu anderen Wertanlagen. Oldtimer sind auch sehr beliebt, oder Boote. Da ist auch die Wartung eine ganz andere sowie die Pflege. Der Besitzer braucht einen Stellplatz oder einen Anlegeplatz. All das sind regelmäßige Folgekosten.
Bei einem Gemälde hat man erstmals – genauso wie bei anderen Sachwerten – den Anschaffungspreis. Und damit erstmals Ruhe.
Je nachdem in welchen Anschaffungsbereich man sich bewegt, ob es z. B. die Klassische Moderne ist oder Zeitgenössische Kunst ist, sollte man auch einen Experten auf den Zustand des Bildes ein Auge werfen lassen.
Wenn man es in einem Auktionshaus gekauft hat oder einer renommierten Galerie, geht man davon aus, das es in einem guten Zustand ist. Dieses spiegelt sich oft auch im Preis wieder.
Manchmal erwirbt man auch Kunstgegenstände aus privater Hand. Hier wäre zumindest eine Quittung gut, damit man im Nachhinein nachweisen kann, dass das Werk einem selbst gehört. In so einem Fall wäre zuerst die Überprüfung des Zustandeswesentlich wesentlich und wenn nötig auch eine artgerechte Restaurierung. So hat man das Bild erstmals in einen einwandfreien Zustand gebracht.
Wichtig – als nächster und letzter Schritt – ist die Auswahl des Ortes, wo das Werk hängen soll. Im Falle einer Grafik (Druck, Zeichnung, Aquarell, Stich, u. ä.) sollte es nicht gegenüber dem Südfenster sein.
Lässt sich dieses nicht vermeiden, so kann man heute auch hier Vorsorge treffen: Man hängt das Bild in einen Rahmen mit Passepartout und vor allem einem UV-Glas, möglichst entspiegelt- das so genannte Museumsglas. Das kostet zwar in der Anschaffung ein Bisschen, aber da hat man seit Anfang an sehr lange seine Freude dran und man ist seiner Pflicht den Wert des Bildes zu erhalten sehr sorgfältig nachgegangen.
Ansonsten hat man mit einem Gemälde, Kunstwerk nicht mehr viel zu tun, bis auf das Abstauben des Bilderrahmens.
Zusammengefasst
- Das Erstellen einer richtigen Erbschaftssteuer ist wichtig. Für die konkrete Bezifferung des Kunstwertes ist eine möglichst rückenfreie Dokumentation oder ein Wertgutachten sehr gut. Hierdurch lassen sich Freibeträge gut begründen.
- Oft sind die Freibeträge ausreichend. In Einzelfällen nicht. Gut ist im Nachhinein dem Finanzamt gegenüber nachweisen zu können, dass Sie dieser Pflicht nachgegangen sind.
- Als Erbe tragen Sie die Mitwirkungspflicht gegenüber den Finanzbehörden die Werthaltigkeit dessen, was man geerbt hat, zu bestimmen. Gut ist, sofort zu überprüfen, ob der Freibetrag ausreicht.
- Im Nachhinein ist eine Dokumentation der Kunstwerke sehr hilfreich bei der Schätzung des aktuellen Preises z. B. zum Zeitpunkt des Erbens.
- Rückwirkend, ein zuverlässiges Wertgutachten zu erstellen, ist wenig zuverlässig. Daher lassen Sie das Wertgutachten sofort erstellen. Es ist eine Absicherung für Sie. Die Kosten können steuermildernd geltend gemacht werden.
- Bei Einkäufen aus privater Hand haben Sie zumindest eine Quittung oder eine vom Vorbesitzer unterschriebene Bestätigung, die bezeugt, dass Sie nun der rechtmäßige Besitzer des Kunstwerkes sind.
- Sammeln Sie alle Unterlagen, wie z. B. Rechnungen, Zertifikate, Zeitungsartikel, Fotos, etc. bezüglich. der Kunstgegenstände.
- Steuerbefreiungsmöglichkeiten:
- Wenn es im öffentlichen Interesse liegt die Kunstgegenstände bzw. die Kunstsammlung zu erhalten. Dieses muss im Einzelfall geprüft werden. Hierbei ist ein Gutachten hilfreich.
- Wenn Kosten zur Wertbestimmung anfallen, z. B. in Form eines Wertgutachtens, können diese z. T. auch steuermindernd geltend gemacht werden.
Quintessenz

Wann wird ein privater Kunstkauf auch steuerlich relevant?
- Wenn Sie innerhalb eines Jahres das Kunstwerk wieder verkaufen.
- Wenn Sie sich auf dem Kunstmarkt wie ein Unternehmer verhalten.
- In Erbfällen, wenn Sie z. B. nicht nachweisen können, dass der Freibetrag greift oder den Wert des Kunstwerks nicht eindeutig benennen können. Hier schützt auch nicht die fehlende Dokumentation über den Erwerb der Kunstgegenstände.
Wann kann ich als Privatperson einen Kunstkauf steuerlich geltend machen?
- Im Erbfall, wenn der Erhalt der Kunstgegenstände bzw. der Sammlung im öffentlichen Interesse liegt und Sie dieses nachweisen können.
- Einen Teil der Kosten, die Sie aufwenden, um zu Beweisen, dass z. B. die Kunstwerke erhaltenswert sind.
- Verhalten Sie sich auf dem Markt wie eine Privatperson und verkaufen Sie das Kunstwerk nach mehr als einem Jahr, ist der Gewinn steuerfrei.
Was Sie beachten sollten, wenn Sie Kunst für Ihr Unternehmen kaufen, das lesen Sie in Teil 2 des Interviews mit der Steuerberaterin Dr. Ariane Reichardt.
Dieser Artikel ist auch für Ihre Freunde lesenswert? Dann teilen Sie diesen mit ihnen:
Sie selbst wollen keinen der Artikel von Art Consulting Mese in Zukunft verpassen? Dann tragen Sie sich für den Kunsttipp ein: